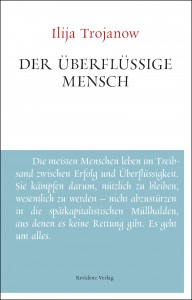|
Diesmal
habe ich für meinen Buchtipp wie schon so oft
ein Werk ausgesucht, das eng mit unseren Themen
Globalisierung / Regionalität verknüpft
ist.
"Der
überflüssige Mensch" - ein Essay zur
Würde des Menschen im Spätkapitalismus
von Ilija Trojanow.
|
|
|
|
|
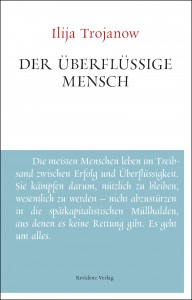
|
|
Wir
sind zu viele auf der Erde: Diese
"Philosophie" des Briten Thomas Malthus
erlebt in der gegenwärtigen Krise
eine Renaissance. Gerade die sogenannte
"Elite" findet Gefallen an dieser Ansicht.
So wurde dieser in Ansprachen unter
anderem von Bill Gates und Warren Buffet
gerne zitiert.
Dass
selbst Charles Darwin in seiner
Evolutionstheorie gerade zum Thema der
Verdrängung einzelner Spezies bei
Malthus Anleihe nimmt, und wiederum die
Wirtschaft dann im Zuge ihrer
Argumentationen pro Kapitalismus Darwin in
diesem Punkt zitiert, ist meiner Ansicht
nach die sprichwörtliche Katze, die
sich in den Schwanz beisst, doch dies nur
am Rande.
Soziale
Ungerechtigkeit halten viele heute
für gottgegeben. Genau dagegen lehnt
sich Ilija Trojanow in seiner
Streitschrift "Der überflüssige
Mensch" auf. Sein Aufruf zu mehr Empathie
ist faktenreich begründet und liefert
gut recherchierte Beispiele
beängstigender
Entwicklungen.
Wer
nichts produziert und nichts konsumiert,
ist überflüssig - so lautet die
mörderische Logik des
Spätkapitalismus. Trojanows Thesen
sind nicht neu: "Das Sein ist ersetzt
worden durch das Konsumieren", heißt
es da. Die Gesetze des Marktes
schränkten demokratische
Freiheitsrechte ein, ökonomisch
Mächtige steuerten gesellschaftliche
Prozesse so, dass ihre Interessen
geschützt, die aller anderen jedoch
missachtet würden. Ob
europäisches Prekariat,
Langzeitarbeitslose in Deutschland oder
Kleinbauern in Indien - unter
ökonomischen Gesichtspunkten
würde eine hohe Anzahl von Menschen
schlichtweg
überflüssig.
|
|
|
|
|
Trojanow wirft die Frage auf, wer heute im
"Raumschiff Erde", einem System wachsender
Bevölkerung und rasant fortschreitender
Automatisierung, verzichtbar und
überflüssig ist.
Die
Kritik des Autors bezieht sich darauf, dass diese
Frage "niemals im Sinne der Gemeinschaft
reflektiert, sondern von der Evidenz der
Machtverhältnisse beantwortet wird." Dazu
führt er etliche konkrete Beispiele an. Sie
sind nachvollziehbar - und überraschend. Wer
weiß schon, dass CNN-Gründer Ted Turner
und Computer-Pionier Bill Gates über
Nahrungsmittelkontrollen einen Rückgang des
weltweiten Bevölkerungswachstums in
Milliardenhöhe ins Auge fassen? Verhungern
sollen die anderen, dabei wären aber gerade
die schwerreichen Einwohner des Westens unter
ökologischen Gesichtspunkten verzichtbar:
2005, so Trojanow, konsumierte das reichste Prozent
der US-Amerikaner genauso viel wie die 60 Millionen
Ärmsten des Landes.
Überflüssig
ist derjenige, dessen Arbeitskraft nicht in den
kapitalistischen Kreisläufen profitabel
genutzt werden kann. Ein Subsistenz- oder
Kleinbauer ist somit extrem überflüssig,
auch wenn er um ein Vielfaches nachhaltiger lebt
als ein Großstädter. Ginge es
tatsächlich um ökologische
Prioritäten, würde man die
Überflüssigen zuallererst bei
Superreichen wie Bill Gates, Mitt Romney und
diverser Tea Party Anhänger ausfindig machen,
deren persönlicher Verbrauch dem ganzer
afrikanischer Städte entspricht. Mit anderen
Worten: Je materiell erfolgreicher jemand im
existierenden System ist, desto ökologisch
destruktiver lebt er.
Aber
der weiße Mann hat sich seit jeher als so
wertvoll wie tausend braune, gelbe oder schwarze
Männer begriffen. In der Masse machen stets
nur die anderen unseren Planeten kaputt.
Hunger
ist der Hauptgrund für unnatürliches
Sterben auf der Erde: Jährlich verhungern 18
Millionen laut den Statistiken der FAO (der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen). Die Hälfte der Kinder
in Indien sind schwer unterernährt, 200.000
Kleinbauern verüben jedes Jahr Selbstmord. Die
Finanzkrise 2007/08 hat laut Angaben der Weltbank
weitere 69 Millionen Menschen in den Hunger
gestürzt. Präziser als die salbungsvolle
Rhetorik von Thomas Malthus ist die nüchterne
Feststellung von Mahatma Gandhi: "The world has
enough for everyone's need, but not for everyone's
greed."
Die
Automatisierung hat, das war allen bewusst, zu
einem Einbruch der Arbeitsplätze im
Produktionssektor geführt. Nur glaubte man
lange Zeit, die Arbeiter im expandierenden
Dienstleistungssektor auffangen zu können.
Dort sorgte ein exzessives Preis-Dumping aber
für Niedrigstlöhne, mit denen kaum ein
Auslangen zu finden war. Das Ergebnis sieht man
jetzt besonders eklatant in Europas gar nicht mehr
so sonnigem Süden.
Die
Angst vor der drohenden Arbeitslosigkeit übt
aber auch auf die Vollbeschäftigten einen
enormen Druck aus. Große Teile der Freizeit
werden jetzt dazu benützt, sich zu
vervollkommnen; in Workshops und Kursen versucht
man, die Grenzen der eigenen Belastbarkeit und
Leistungsfähigkeit immer weiter in die
Höhe zu schrauben.
In
der ersten Welt sorgt da das ständig wachsende
Heer an Arbeitslosen für Besorgnis. Eine
Ursache dafür ist ein durch die Globalisierung
völlig deregulierter Arbeitsmarkt. Für
ausländische Investoren zählt da oft nur
der schnelle Profit.
Trojanows
Essay ist eine humanistische Streitschrift wider
der Überflüssigkeit des Menschen. In
seinen eindringlichen Analysen schlägt er den
Bogen von den Verheerungen des Klimawandels
über die Erbarmungslosigkeit neoliberaler
Arbeitsmarktpolitik bis zu den massenmedialen
Apokalypsen, die wir, die scheinbaren Gewinner, mit
Begeisterung verfolgen. Doch wir täuschen uns:
Es geht auch um uns. Es geht um alles.
Ilija
Trojanow, geb. 1965 in Sofia, Bulgarien, ist ein
vielfach ausgezeichneter deutscher Schriftsteller,
Übersetzer und Verleger.
Bekannt wurde er vor allem durch seinen 2006
erschienenen Roman "Der Weltensammler", der mit dem
Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde.
"Der
überflüssige Mensch" ist im August
2013 im Residenz Verlag unter der ISBN
9783701716135 erschienen, umfasst 90 Seiten
und ist für diejenigen, die konsumieren und
sich somit dem System nützlich erweisen, im
Buchhandel um EUR 16,90 erhältlich.
|